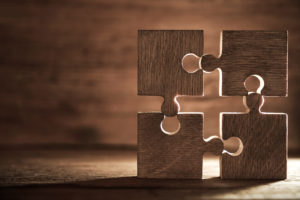Beratung von Nonprofit-Organisationen im Gemeinnützigkeitsrecht

Was bedeutet Gemeinnützigkeit?
Als gemeinnützig werden allgemein Tätigkeiten oder Organisationen bezeichnet, die nicht auf Gewinn ausgerichtet sind. Aber nicht jedes uneigennützige Verhalten ist auch gemeinnützig im Sinne des Steuerrechts. Nur bestimmte, in der Abgabenordnung genannte Zwecke sind steuerbegünstigt. Neben kirchlichen oder mildtätigen Zwecken sind das etwa Jugendförderung, Bildung, Sport, Gesundheit oder Tierschutz.
Wer oder was kann gemeinnützig sein?
Den Status der Gemeinnützigkeit können nur Körperschaften erlangen. Dazu zählen z.B.
- Vereine (eingetragen oder nicht eingetragen)
- Kapitalgesellschaften (gGmbH, gUG, gAG)
- Stiftungen (rechtsfähige oder nicht rechtsfähige)
- Genossenschaften
Nicht gemeinnützig sein können dagegen Personengesellschaften oder Einzelpersonen.
Satzung und tatsächliche Geschäftsführung müssen übereinstimmen
Die Steuervergünstigung wird nur gewährt, wenn die Körperschaft nach ihrer Satzung und ihrer tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und unmittelbar steuerbegünstigte Zwecke verfolgt:
- Satzung
In der Satzung muss der steuerbegünstigte Zweck (oder mehrere Zwecke) konkret bezeichnet werden. Andere, nicht steuerbegünstigte Zwecke dürfen nicht aufgenommen werden. Die Satzung muss bestimmte Formulierungen der Mustersatzung enthalten. - Tatsächliche Geschäftsführung
Es reicht nicht aus, dass die Satzung gemeinnützige Zwecke enthält – diese Ziele müssen auch wirklich verfolgt und umgesetzt werden. Zur tatsächlichen Geschäftsführung gehört alles, was die Körperschaft tut, also die Verwendung ihrer Mittel, das Verhalten von Vorstandsmitgliedern oder Veröffentlichungen auf der Website. Steht dieses Verhalten im Widerspruch zur Satzung, ist die Gemeinnützigkeit in Gefahr.
Anforderungen an die Selbstlosigkeit
Voraussetzung für die Gemeinnützigkeit ist zudem, dass die steuerbegünstigten Zwecke selbstlos verfolgt werden. Dazu bedeutet:
- Es dürfen keine eigenwirtschaftlichen Zwecke verfolgt werden,
- es dürfen keine Gewinne an Mitglieder bzw. Gesellschafter ausgeschüttet werden, weder während noch bei Beendigung der Mitgliedschaft,
- gezahlte Vergütungen (z.B. an Vorstandsmitglieder) müssen verhältnismäßig sein,
- die Verwendung des Vermögens für gemeinnützige Zwecke muss auch über das Ende der gemeinnützigen Körperschaft hinaus sichergestellt sein (Vermögensbindung),
- Mittel müssen zeitnah, d.h. in der Regel nach zwei Kalenderjahren verwendet werden.
Vier-Sphären-Modell zur Abgrenzung steuerbefreiter und steuerpflichtiger Einnahmen
Nur weil eine Körperschaft als gemeinnützig anerkannt ist, bedeutet das noch nicht, dass auch alle ihre Einnahmen steuerbefreit und alle Ausgaben nicht abzugsfähig sind. Jede Betätigung ist einer der vier Sphären der Gemeinnützigkeit zuzuordnen:
- Ideelle Sphäre (z.B. Spenden und Mitgliedsbeiträge)
- Vermögensverwaltung (z.B. Darlehenszinsen und Dividenden)
- Steuerpflichtige wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (z.B. Vereinsgaststätte)
- Zweckbetriebe (z.B. Kindergarten)
Grundsätzlich sind bei gemeinnützigen Organisationen nur wirtschaftliche Geschäftsbetriebe steuerpflichtig. Häufig kommt es deshalb auf die Abgrenzung zwischen Zweckbetrieben und steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben an.
Wie erlangt man den Status der Gemeinnützigkeit?
Das Finanzamt stellt die Steuerbefreiung nach Abgabe der Körperschaftsteuererklärung fest. Liegen die Voraussetzungen vor, erlässt es einen Freistellungsbescheid. Für neu gegründete Körperschaften ist es sinnvoll, den Entwurf der Satzung oder des Gesellschaftsvertrags zuvor mit dem Finanzamt abzustimmen und zudem die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen gesondert feststellen zu lassen.
Leistungen der Kanzlei Vielwerth Junginger im Bereich Gemeinnützigkeit
Gerne unterstützen wir dich unter anderem bei diesen Themen:
- Erlangung der Gemeinnützigkeit,
- Gestaltung von Satzungen und Gesellschaftsverträgen gemeinnütziger Körperschaften,
- Durchführung von Einspruchs- und Klageverfahren gegen Entscheidungen des Finanzamts,
- Erstattung von Gutachten zur Angemessenheit von Vorstands- und Geschäftsführervergütungen,
- Beratung zur Gemeinnützigkeit bei der Körperschaftsteuer, Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Erbschaft- und Schenkungsteuer,
- Beratung bei (drohendem) Verlust der Gemeinnützigkeit.
Rechtsanwälte für Gemeinnützigkeitsrecht – Deine Experten für Nonprofit-Organisationen
Du möchtest eine gemeinnützige Körperschaft gründen oder hast Fragen zu Einzelheiten im Gemeinnützigkeitsrecht? Schreib gerne oder ruf direkt an, um einen Termin zu vereinbaren.