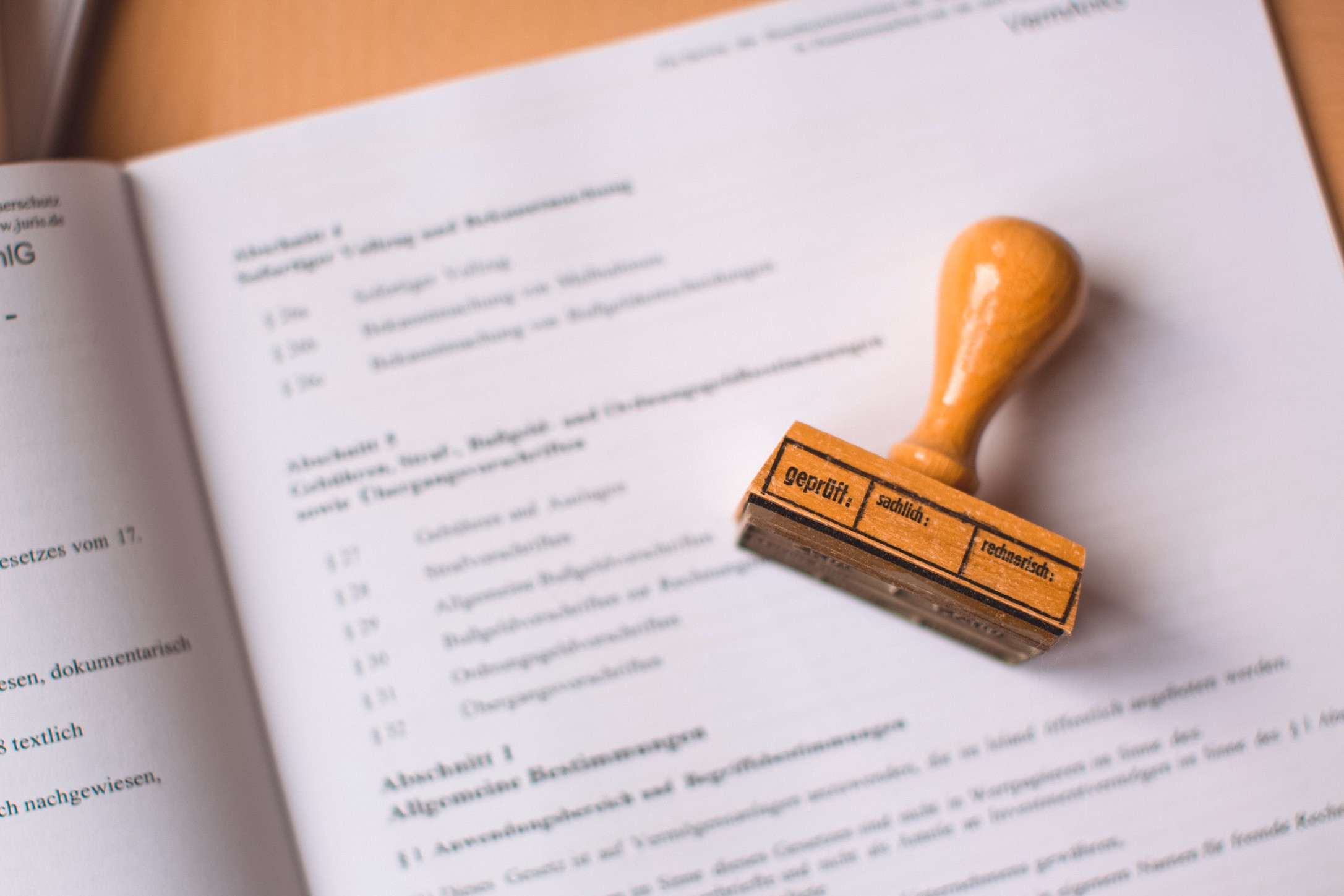
Um was ging es in dem Fall?
Der Schulträger mehrerer berufsbildender Ersatzschulen in Berlin erhob ein nach Einkommensverhältnissen gestaffeltes Schulgeld, das mindestens 100 Euro monatlich betrug. Aufgrund gestiegener Kosten wollte der Träger das Mindestschulgeld auf 120 Euro anheben und beantragte hierfür eine Genehmigung bei der Senatsverwaltung. Diese teilte in mehreren Schreiben mit, dass die Anhebung gegen das Sonderungsverbot verstieße und sie deshalb nicht zustimmen könne. Ein Schulgeld von mehr als 100 Euro im Monat würde verhindern, dass allen sozialen Schichten der Schulbesuch offen stehe.
Hiergegen erhob der Schulträger Klage zum Verwaltungsgericht (VG) Berlin. Er beantragte, die Senatsverwaltung zur Genehmigung der geplanten Schulgelderhöhung zu verpflichten oder hilfsweise festzustellen, dass sie nicht gegen das Sonderungsverbot verstoße.
VG: Klage unzulässig
Das VG wies die Klage des Schulträgers ab, ohne sich inhaltlich mit der Frage der zulässigen Höhe des Mindestschulgelds zu beschäftigen. Die Klage sei nämlich bereits unzulässig, und zwar sowohl der Hauptantrag (Verpflichtungsklage) als auch der Hilfsantrag (Feststellungsklage).
Schreiben der Senatsverwaltung waren keine Verwaltungsakte
Bei den Schreiben der Senatsverwaltung handele es sich nicht um Verwaltungsakte mit Regelungswirkung, die aufgehoben und durch eine andere Entscheidung ersetzt werden könnten. Denn weder das Berliner Schulgesetz noch das Grundgesetz sähen eine Genehmigungspflicht für die Erhebung von Schulgeld an Privatschulen vor. Die Schulbehörde kann also eine Erhöhung weder verbieten, noch muss der Schulträger überhaupt eine Genehmigung beantragen.
Feststellungsklage unzulässig, weil Sonderung nicht nur von Mindestschulgeld abhängt
Auch die hilfsweise erhobene Feststellungsklage sei unter anderem deshalb unzulässig, weil es an einem feststellungsfähigen Rechtsverhältnis fehle. Ob durch die Anhebung des Mindestschulgelds von 100 Euro auf 120 Euro tatsächlich gegen das Sonderungsverbot verstoßen werde, könne nämlich nicht isoliert von den sonstigen Zugangsvoraussetzungen beurteilt werden. Ob ein Schulgeldmodell zu einer Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen führe, sei von mehr Faktoren als nur dem Mindestbetrag abhängig.
Kein vorbeugender Rechtsschutz gegen noch nicht erlassene Aufhebung der Schulgenehmigung
Zudem sei die Feststellungsklage auch deshalb nicht statthaft, weil es dem Schulträger zuzumuten sei, den Erlass eines belastenden Verwaltungsakts abzuwarten und dann gegen diesen zu klagen. Die Senatsverwaltung habe zwar bei einem Verstoß gegen das Sonderungsverbot grundsätzlich die Möglichkeit, die Schulgenehmigung aufzuheben – hier sei aber völlig unklar, ob sie das tatsächlich beabsichtige.
Privatschulen sollten ihre Rechtsschutzmöglichkeiten kennen
Im vorliegenden Fall hat der Schulträger durch seine Klage letztlich nichts erreicht – weil die Schreiben der Senatsverwaltung keinen rechtlichen Gehalt hatten. Besser (und günstiger) wäre es gewesen, abzuwarten, ob die Behörde wirklich von ihrem einzigen Sanktionsmittel – die Aufhebung der Schulgenehmigung – Gebrauch machen will. In der Praxis ist die Aufhebung allein wegen eines angeblichen Verstoßes gegen des Sonderungsverbots sehr selten, sodass ein Gerichtsverfahren möglicherweise hätte vermieden werden können. Vor der Erhebung einer Klage sollte in jedem Fall geprüft werden, welche Rechtsbehelfe im konkreten Fall zulässig sind und überhaupt zum Erfolg führen können.






